FÜHLE NICHT! – Der Muskel des Wegdrückens, den wir als Kinder aufgebaut haben
Hey, DU!
Es war wie ein unsichtbares Gewicht auf meinem Herzen. Diese drei Worte, die so leicht über die Lippen kommen sollten, schienen für mich unmöglich. „Ich liebe dich“ – Worte, die Nähe, Vertrauen und echte Hingabe bedeuten. Doch in meinem Inneren blieben sie stecken, wie ein stummer Knoten, der sich immer enger zog. Jedes Mal, wenn ich sie sagen wollte, schnürte sich mir die Kehle zu, als ob mein ganzer Körper eine Mauer aufbauen würde, um diesen Gefühlen keinen Raum zu geben. Gefühle könnten mich zerbrechen, hatte ich früh gelernt. Gefühle könnten alles, was noch halbwegs in mir standhielt, aus der Bahn werfen.
Vielleicht spürst du es auch – diesen stummen Befehl: „Fühle nicht!“ Ein Befehl, der so fest in uns verankert ist, dass wir ihn nicht mehr in Frage stellen, der uns schützt, aber auch fesselt. In einer Kindheit voller Chaos und Unsicherheit lernt man, dass Gefühle unsichtbare Gefahren bergen: Sie könnten zu viel Schmerz aufdecken, zu viele Fragen aufwerfen, zu viele Wunden freilegen. Gefühle bedeuteten das Risiko, wieder enttäuscht zu werden, wieder nicht gesehen zu werden – also sperrten wir sie tief weg, versteckten sie hinter einer Fassade des Funktionierens, des Weitermachens.
Und irgendwann, fast unmerklich, wurde dieser Schutz zu einem Gefängnis. Nicht zu fühlen bedeutete, sicher zu bleiben. Doch was uns früher das Überleben sicherte, wird im Erwachsenenleben zu einer schweren Last. Diese Mauer, die uns so lange geschützt hat, trennt uns jetzt von echten Verbindungen, von echter Nähe – von den Menschen, die uns vielleicht wirklich lieben könnten, wenn wir uns nur öffnen würden.
Der Schmerz, der nicht gefühlt werden durfte
Wenn du in einer suchtbelasteten Familie aufgewachsen bist, kennst du es vermutlich nur zu gut: Gefühle zu zeigen, könnte Unheil bringen. Da war die Traurigkeit, die in dir aufstieg, wenn du zum x-ten Mal enttäuscht wurdest. Da war die Angst, die sich in deine Knochen fraß, weil du nie wusstest, was als nächstes passieren würde. Und da war die tiefe, nagende Enttäuschung, die dir sagte: Du bist nicht wichtig genug, um geliebt zu werden. Gefühle, die eigentlich ganz natürlich sind – Trauer, Angst, Wut – wurden schnell zu einem gefährlichen Untergrund. Denn Gefühle durften einfach nicht sein.
Also lernte ich, wie viele von uns, dass es sicherer ist, diese Gefühle einfach „wegzudrücken“. Sich nicht zu spüren wurde ein Überlebensmechanismus – ein Schutzpanzer gegen die ständigen Enttäuschungen und gegen den Schmerz, der meinen Alltag durchzog. Dieser Schmerz, der immer da war, wie eine stille Bedrohung im Hintergrund. Doch er durfte nicht nach außen dringen, er musste verborgen bleiben, um die fragile Stabilität meiner Welt nicht zu gefährden.
Vielleicht haben auch dir die Erwachsenen in deinem Leben, bewusst oder unbewusst, diese Regel aufgedrängt: „Fühle nicht, dann kann dich nichts verletzen.“ Ich erinnere mich an das Gefühl, dass ich an meinen Emotionen gezweifelt habe, dass sie mich nur noch verletzlicher machen würden. Jedes Mal, wenn meine Gefühle an die Oberfläche drängten, wurde ich daran erinnert: Gefühle sind gefährlich. Sie bringen Chaos. Sie schaffen nur neue Probleme.
Und so lernte ich, die eigene Traurigkeit und die Enttäuschungen unter einem stummen Panzer zu verbergen. Es wurde zur Normalität. Doch was als Schutz begann, wurde bald zum Panzer. Ein Panzer, der mich gefangen hielt – sicher vor den Stürmen, die meine Gefühle auslösen könnten, aber auch sicher vor dem Leben, vor echter Nähe, vor echter Verbindung.
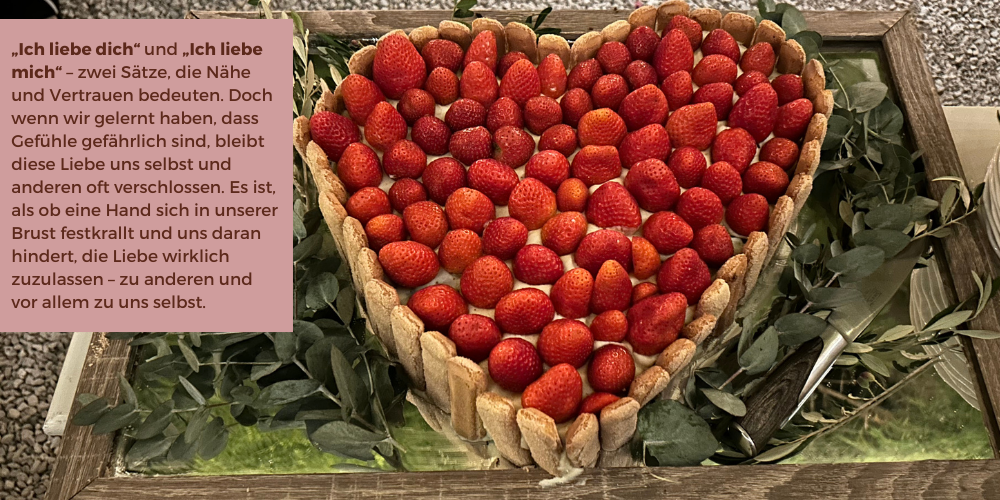
„Ich liebe dich“ – doch was ist mit „Ich liebe mich“?
Es ist eine der schwersten Lektionen, vielleicht die schwerste überhaupt: sich selbst zu lieben. Denn wenn wir früh gelernt haben, dass unsere Gefühle gefährlich sind, dass unsere Bedürfnisse zu viel oder eine Last sind, dann bleibt auch die Liebe zu uns selbst im Verborgenen. Diese Liebe zu uns selbst, die eigentlich unser innerstes Fundament sein sollte, wird zu einem zarten, fast unsichtbaren Flüstern, das sich kaum zu Wort meldet.
Wie soll ich mich lieben, wenn ich gelernt habe, dass ich nicht gut genug bin? Dass ich zu laut, zu fordernd, zu schwach oder zu viel bin? Wir haben vielleicht gehört: „Sei stark, zeig keine Schwäche.“ Vielleicht haben wir gespürt, dass unsere Tränen, unsere Freude oder unsere Wut unwillkommen waren. Und irgendwann – fast ohne dass wir es bemerkt haben – begann diese leise Stimme, die sagt: „Ich liebe mich“, zu verkümmern.
Selbstliebe verlangt, dass wir uns sehen, uns annehmen, uns umarmen – genau so, wie wir sind. Aber das kann schwer sein, wenn wir so oft das Gegenteil gespürt haben. Wenn uns die Welt gezeigt hat, dass wir uns kleinmachen müssen, dass wir die eigenen Bedürfnisse verstecken sollten. Diese alte Regel „Fühle nicht“ wird dann zur Regel „Liebe dich nicht“.
Und so bleibt die Liebe zu uns selbst unerfüllt, ein Raum in uns, der sich leer anfühlt.
Vielleicht fällt es dir sogar schwer, dich im Spiegel anzusehen und „Ich liebe dich“ zu dir selbst zu sagen. Es klingt fremd, vielleicht sogar falsch. Doch diese Liebe ist die wichtigste. Sie ist die Liebe, die alle anderen Beziehungen prägt, die uns zeigt, dass wir wertvoll sind, ohne etwas leisten zu müssen. Sie ist die Grundlage, auf der wir heilen, die Mauer abtragen und wieder Vertrauen in uns selbst entwickeln können.
„Ich liebe mich.“ Diese Worte flüstern uns zu, dass wir genug sind, dass wir gut sind, genau so, wie wir sind. Wenn wir beginnen, diese Liebe zuzulassen, uns selbst anzunehmen, mit all den Narben, den Wunden und den Ängsten, dann öffnet sich ein Raum, in dem wir endlich frei sein können. Ein Raum, der uns erlaubt, uns selbst so zu umarmen, wie wir es uns immer gewünscht haben – bedingungslos, ohne Angst, ohne Zurückhaltung.
Ich liebe mich – diese Worte sind die Grundlage für alles, was wir im Leben an Nähe und Vertrautheit erfahren können. Doch wie soll man das sagen, wie soll man es wirklich fühlen, wenn man gelernt hat, dass Gefühle nur verletzlich machen? Wenn Liebe nicht ein sicherer Hafen war, sondern ein unbekanntes, unzugängliches Land, das zu betreten Gefahr bedeutete?
Für uns, die wir gelernt haben, die eigene Seele zu verschließen, fühlt sich auch die Liebe zu uns selbst fremd und riskant an. „Ich liebe dich“ und „Ich liebe mich“ – beide Sätze scheinen wie verschlossene Türen. Sie stehen für Nähe, für Vertrauen, für das große Wagnis, sich ganz zu zeigen, so wie man wirklich ist, mit all den Wunden und Ängsten, die wir so gut versteckt halten. Und so bleibt uns die Liebe zu uns selbst ebenso verschlossen wie die Liebe zu anderen.
Diese Schutzmauer, die uns als Kinder oft das Überleben sicherte, lässt auch im Erwachsenenalter die Liebe nicht hindurch. Es ist, als ob sich eine Hand in unserer Brust festkrallt und uns davon abhält, uns wirklich so zu sehen und anzunehmen, wie wir sind. „Ich liebe dich“ und „Ich liebe mich“ – wie soll man das sagen, wenn man gelernt hat, nicht zu fühlen? Die Angst ist da: Was, wenn ich mich selbst liebe und dann feststellen muss, dass ich nicht genug bin?
Diese kindlichen Wunden, die wir davongetragen haben, verhindern oft, dass wir uns hingeben können – weder anderen, noch uns selbst. Wir bleiben zurückhaltend, verschlossen, selbst in Momenten, in denen Nähe und Annahme möglich wären. So leben wir das Leben mit angezogener Handbremse, sicher, aber auch fern von der Lebendigkeit, die Liebe mit sich bringt.
Die bittere Konsequenz: Leben ohne Lebendigkeit
Wenn wir unsere Gefühle unterdrücken, lassen wir nicht nur den Schmerz nicht zu – wir schneiden uns auch von der Freude und Lebendigkeit ab. Das Leben wird wie durch einen Grauschleier wahrgenommen. Wir überleben, aber wir leben nicht wirklich. Diese Taubheit wird zur ständigen Begleiterin, und irgendwann fühlen wir uns selbst fremd und anders.
Es ist ein hoher Preis, den wir zahlen, oft ohne zu wissen (ohne es zu spüren), dass wir ihn gezahlt haben. Doch die Seele lässt sich auf Dauer nicht ignorieren. Irgendwann, vielleicht in Momenten der Stille oder wenn das Leben uns besonders herausfordert, klopft das Fühlen wieder an. Es will gelebt, es will geheilt werden.
Was es mit uns macht, endlich zu fühlen
Aber wie können wir das Fühlen wieder zulassen, wenn es uns jahrelang untersagt wurde? Der Weg ist kein schneller, er fordert Mut und Geduld. Wenn wir beginnen, diese alte Regel „Fühle nicht!“ loszulassen, erlauben wir uns auch, das zu spüren, was wir all die Jahre verdrängt haben. Es kann schmerzhaft sein, ja – aber auch unglaublich befreiend.
Wir entdecken, dass Gefühle nicht zerstörerisch sind, sondern uns in die Lebendigkeit führen. Sie sind wie ein inneres Licht, das uns wärmt und zeigt, dass wir wirklich da sind. Wir spüren, dass wir uns selbst annehmen dürfen, dass wir lieben dürfen – ohne Angst.
Der Weg zurück zum Fühlen – ein kleiner Anfang
- Erlaube dir kleine Momente des Spürens: Beginne mit kleinen Emotionen, die aufkommen, und sei neugierig. Frage dich: „Wie fühle ich mich gerade?“ – ohne zu urteilen oder etwas verändern zu wollen. Lass einfach zu, was da ist.
- Finde deinen sicheren Raum: Schaffe dir Momente, in denen du dich sicher genug fühlst, deine Gefühle zuzulassen – sei es mit einem Freund, einem Tagebuch oder einer stillen Stunde für dich selbst.
- Vertraue darauf, dass Gefühle kommen und gehen dürfen: Gefühle sind keine bedrohliche Flut, die uns überwältigt. Sie sind wie Wellen, die kommen und gehen, wenn wir ihnen Raum geben. Mit jedem Mal, wenn du eine kleine Welle zulässt, wird der Muskel des Wegdrückens ein bisschen schwächer.
Du bist mehr als das Schweigen deiner Seele
Wenn du dich in diesen Zeilen wiedererkennst, wenn du die Schwere des „Nicht-Fühlens“ kennst und vielleicht den Schmerz, nicht „Ich liebe dich“ sagen zu können – weder zu anderen noch zu dir selbst – dann weißt du: Du bist nicht allein. Du hast die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen und die Regel „Fühle nicht!“ langsam hinter dir zu lassen.
Es ist an der Zeit, die Mauern abzubauen und die Lebendigkeit zu spüren, die dir so lange vorenthalten wurde. Denn du bist wertvoll. Deine Gefühle sind wertvoll. Das Leben möchte dich mit all deinen Tiefen und Höhen.
sei MUTIG. sei FREI. sei DU
Deine Christina für J. und meine Kinder







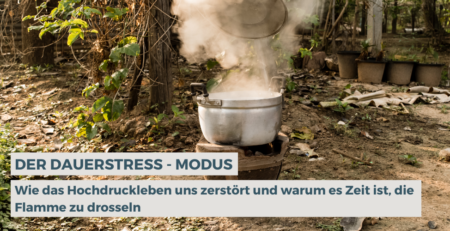




Schreibe einen Kommentar